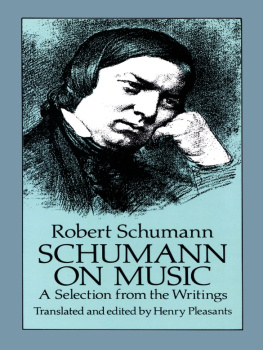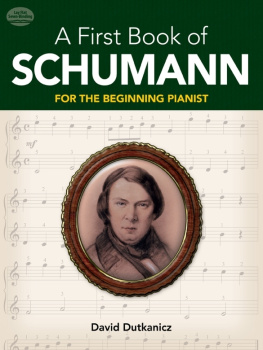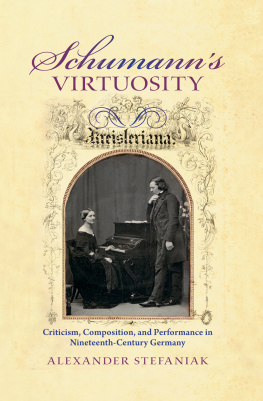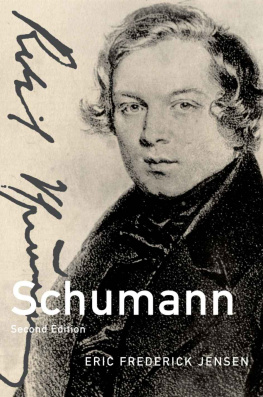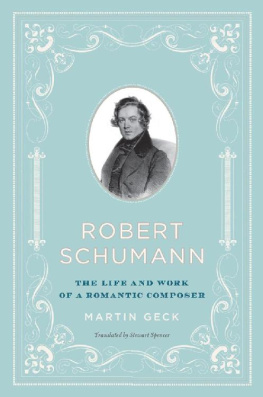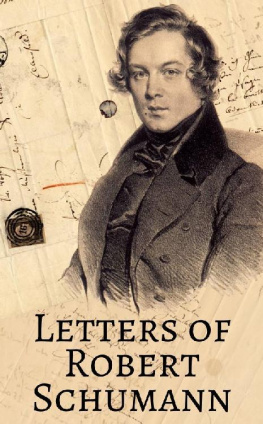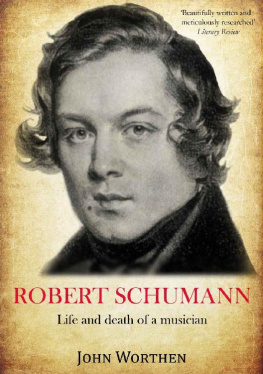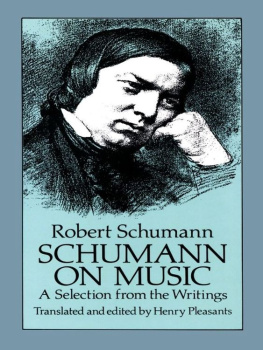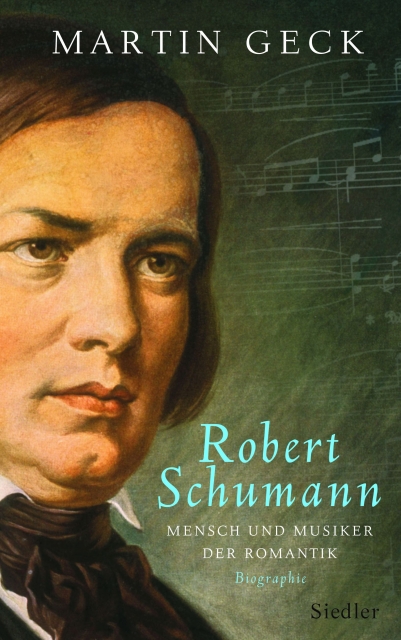Inhaltsverzeichnis
Prolog
Vorzglich stark ausgebildet die Organe der Vorsicht, - Aengstlichkeit, die sogar meinem Glck im Wege stnde, - der Musik, - der Dichterkraft - edlen Strebens - groen knstlerischen aber edlen Ehrgeizes - groer Wahrheitsliebe - groer Redlichkeit - groen Wohlwollens - Gemth durch und durch - Formensinn - Bescheidenheit - Festigkeit - (Phrenologische Studien v. Nol an m[einem] Kopf - Maxen, d. 1 Juni)
Aus Robert Schumanns Tagebuch
Diese Tagebucheintragung Schumanns stammt vom 1. Juni 1846. Robert Schumann und seine Frau Clara sind auf dem Schloss und Rittergut Maxen bei Dresden zu Besuch, das dem ebenso wohlhabenden wie kunstsinnigen Major a. D. Friedrich Serre gehrt. Man ist zu Tisch eingeladen; Schumann spielt hernach Whist und lernt Capitn Nol kennen, der am Abend an ihm eine merkwrdige phrenologische Untersuchung vornimmt, wie es auch im Haushaltbuch unter dem gleichen Datum heit.
Die Rede ist von dem englischen Phrenologen Robert R. Nol, der gerade in Dresden weilt, um sich mit dem Arzt, Maler und Naturforscher Carl Gustav Carus ber das gemeinsame Forschungs-Gebiet auszutauschen und die zweite Auflage seiner Phrenologie oder Anleitung zum Studium dieser Wissenschaft, mit Bercksichtigung der neueren Forschungen auf dem Gebiet der Physiologie und Psychologie vorzubereiten; diese wird kurz darauf in der Arnoldischen Buchhandlung in Dresden und Leipzig erscheinen.
Phrenologie - also der Versuch, von der Schdelform eines Menschen auf seine Charaktereigenschaften zu schlieen - hat damals Hochkonjunktur. Und weil die dabei blichen Messungen nicht zuletzt kriminologischen Interessen dienen, wird Schumann dem bekannten Mann seinen Kopf nicht ohne leichtes Gruseln hingehalten haben - freilich auch mit der seltsamen und doch gar nicht so seltenen Begierde, von einem anderen ber das eigene Wesen aufgeklrt zu werden. Und er wird belohnt: Die ihm attestierte ngstlichkeit, mit der er sich ja wirklich Tag fr Tag herumschlgt, darf er knftig unter schicksalhafter Anlage buchen. Und alle anderen von Nol konstatierten Anlagen sind vortrefflich: edles Streben, edler knstlerischer Ehrgeiz, Wahrheitsliebe, aber auch Formensinn und Festigkeit.
Natrlich wei der Phrenologe, wen er da am Abend des zweiten Pfingsttags 1846 vor sich hat; und sicherlich ist er welt- und berufserfahren genug, um nicht nur Schumanns Kopf zu inspizieren, sondern seinen prominenten Klienten auch mithilfe anderer Indizien so zu taxieren, dass dieser vermutlich zwar etwas aufgewhlt, aber doch erhobenen Hauptes wieder zu den Gsten zurckkehren kann. Und der Autor ist von dem Charakterbild, das hier gezeichnet wird, noch nach mehr als 150 Jahren berhrt. Denn so vage es ist: Verwendete man es fr ein Quiz, so wrde ein leidlicher Kenner der Musikgeschichte in der Tat eher auf Schumann tippen denn auf Beethoven, Wagner oder Meyerbeer. Und da geht es vor allem um eine charakteristische Ambivalenz:
Auf der einen Seite die diagnostizierten Zge von Vorsicht und ngstlichkeit, die Schumann bestndig qulen, ihn immer wieder nervenschwach und partiell menschenscheu erscheinen lassen. Es sind Zge, die ihn im produktiven Sinn dazu veranlassen, lieber an der eigenen Persnlichkeit zu arbeiten, als andere durch Neid, Kritik oder Herablassung herauszufordern. Kaum je hat Schumann in seiner Neuen Zeitschrift fr Musik einen Musikerkollegen in Grund und Boden kritisiert oder einen Zeitgenossen in privaten uerungen beleidigt. Er liebte weder den verbalen Zweikampf noch die besserwisserische Kritikergeste. Stattdessen hatte er Gre genug, um den jungen Johannes Brahms enthusiastisch als seinen Nachfolger im Geist zu feiern und einen Hector Berlioz mit seiner Symphonie fantastique, obwohl er diese im Innersten nicht mochte, als Genie des romantischen Realismus la franaise zu wrdigen.
Auf der anderen Seite ein bewundernswerter Mut, sich immer wieder der Welt zu stellen und ihr kmpferisch entgegenzutreten. Das beginnt mit dem jahrelangen Kampf um die Braut Clara, der schlielich durch einen Prozess zugunsten der Liebenden entschieden wird. Es setzt sich fort in Schumanns Sorge fr die immer grer werdende Familie, fr deren Zusammenhalt zwar vor allem die Gattin, jedoch zu nicht geringen Teilen auch er selbst verantwortlich ist. Mehr als das: All seine ngste hindern ihn nicht, Clara auf Reisen zu begleiten, Gesellschaften zu besuchen, Chre zu dirigieren, Orchester zu leiten. Dass er - uerer Hhepunkt seiner Laufbahn - die verantwortliche Stellung eines Stdtischen Musikdirektors in Dsseldorf antritt, mag dann freilich ber seine Krfte gegangen sein und seinen letztendlichen Zusammenbruch beschleunigt haben.
Doch zuvor fehlt es ihm nicht an beruflicher Tchtigkeit: Er wei mit Verlegern zu verhandeln; und die gleichsam freihndige Grndung der Neuen Zeitschrift fr Musik (siehe Seite 59ff.) ist geradezu ein sowohl unternehmerischer als auch kulturpolitischer Geniestreich. Ganz zu schweigen von seinem Mut in knstlerischen Dingen. Der junge Schumann, weitgehend Autodidakt, ist klug genug, in seinem ffentlichen Wirken zunchst vor allem auf die Klaviermusik zu setzen: Das Komponieren am Klavier betrachtet er vorderhand als sein ureigenes Metier; auerdem lsst sich dieses Genre am leichtesten verlegen. Doch ab dem dreiigsten Lebensjahr wagt er sich weiter vor: Zunchst entstehen als Zeichen gewachsenen Selbstbewusstseins serienweise Klavierlieder; es folgen gro besetzte Instrumentalwerke, Kammermusik und schlielich Oratorien und eine Oper. Mit der Rheinischen Sinfonie gelingt Schumann in den letzten Lebensjahren ein Werk von solcher Gelstheit und Lebensfreude, dass es auch sorgloseren Komponistengemtern, als Schumann eines war, zur Ehre gereicht htte.
Also mehr als nur Ambivalenzen, nmlich extreme Spannungen, die Schumanns Umgebung, ja sogar Teile des groen Publikums mitbekamen - und in hohem Ma tolerierten. Man darf in dieser Hinsicht die gebildete Gesellschaft des 19. Jahrhunderts nicht unterschtzen: Wer wrde heute einem Robert Schumann die Stelle eines Dsseldorfer Musikdirektors anbieten, anstatt von vornherein in Rechnung zu stellen, dass der wohl nicht der Richtige frs Image der Stadt sein knnte. Der ungarische Schriftsteller Bla Hamvas schrieb um 1960 ber das 19. Jahrhundert mit erkennbarer Sympathie: Jahrhundert der Wahnsinnigen. Hlderlin, Schumann, Gogol, Baudelaire, Maupassant, van Gogh, Nietzsche. Heute sind wir nicht mehr fhig, wahnsinnig zu werden. Und ebenso wenig sind wir fhig, Wahnsinnige, die sich nicht unserem eigenen Wahnsinn anpassen, zu ertragen, knnte man fortfahren.
Damit soll hier nicht die im 19. Jahrhundert beliebte These vom Zusammenhang von Genie und Wahnsinn verfolgt, jedoch der Blick auf ein Milieu gelenkt werden, in dem ein Knstler auch dann leidlich ungeschoren und ohne jedwede Anerkennung zu verlieren seinen Weg gehen konnte, wenn er nicht ins Schema passte. Das Unangepasste war damals noch nicht in die Subkultur abgewandert, verkrperte vielmehr das schlechte Gewissen des gut situierten Brgers, der noch ahnte, was alles auf der Strecke blieb, wenn Gewinnmaximierung zur obersten Devise wurde.
So gesehen ist dieses Buch nicht nur aus Bewunderung fr einen schwierigen, sich jedoch vor dem Zusammenbruch niemals aufgebenden Knstler und Musikintellektuellen geschrieben, sondern auch aus Respekt vor einer Gesellschaft, die eine solche Persnlichkeit zwar nicht auf Hnden trug, ihren Wert aber auch nicht wie selbstverstndlich am Grad ihrer Vermarktbarkeit ma.